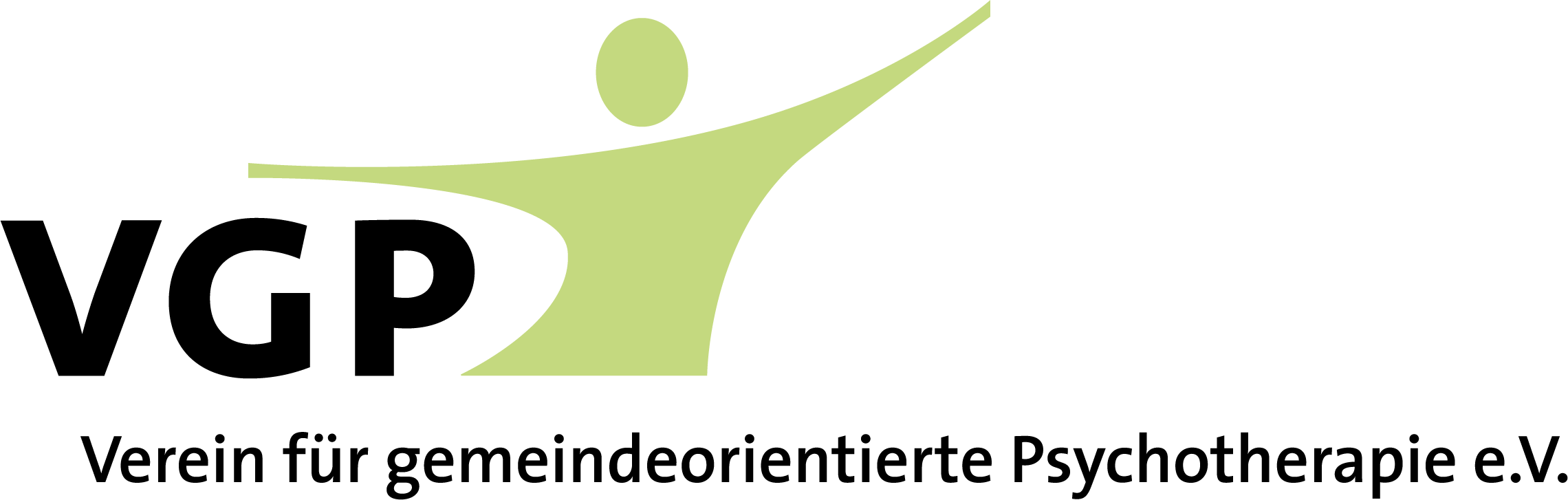11. Kongress für gemeindeorientierte Suchttherapie
(ÜBER)-LEBEN MIT EINER SUCHTERKRANKUNG
Liebe SuchtexpertInnen, liebe FreundInnen des Community Reinforcement Approaches,
Am 18./19. April 2024 wird im Krankenhaus am Urban unser 11.
Kongress für gemeindeorientierte Suchttherapie stattfinden. Herr Prof. Andreas Bechdolf als Chefarzt der Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Frau Dr. Petra Hußmann und die dortigen KollegInnen der Suchtabteilung werden unsere Gastgeber sein. Die Tagung wird im Klnikum selbst stattfinden, was mit einer Begrenzung der TeilnehmerInnenzahl auf 120 verbunden ist. Wegen dieser Teilnahmebegrenzung können wir in diesem Jahr keine Zehnertíckets anbieten.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen endlich das Tagungsprogramm präsentieren können. Unter dem Titel „(Über)-Leben mit einer Suchterkrankung: Krisenmanagement und Existenzsicherung mit dem CRA“ wollen wir uns mit konzeptionellen Fragen und marginalisierten Gruppen der Suchtarbeit beschäftigen.
Am Vorabend der Tagung besteht Gelegenheit zu einem gemeinsamen Zusammentreffen. Den Abend des 18. Aprils, an dem sonst der Gesellschaftsabend stattfindet, haben wir bewusst nicht verplant, um Gelegenheit zu geben, abends das Nachtleben von Berlin zu genießen. Wir sind gerne bereit, bei der Herstellung von Kontakten behilflich zu sein, wo der Wunsch besteht, abends gemeinschaftlich etwas zu unternehmen. Vermerken Sie das einfach auf Ihrem Anmeldebogen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen – und warten Sie wegen der begrenzten TeilnehmerInnenzahl nicht zu lang mit der Anmeldung.
Mit herzlichem Gruß !
Ihr
Dr. Martin Reker
VGP-Vorsitzender
Ltd Arzt der Abt. Abhängigkeitserkrankungen
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel
Vorträge 2024
Vortrag: 09.30 Uhr | Martin Reker
Martin Reker: Anwaltschaft für suchtkranke Menschen in stürmischer Zeit: Worauf es wirklich ankommt!
03.01.2025 BERLIN
Dr. Martin Reker, Leitender Arzt der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel, führt mit seinem Plädoyer für ein besonderes Engagement für chronifizierte Suchtkranke in den 11. Kongress für gemeindeorientierte Suchttherapie ein. Er verweist darauf, dass in Zeiten begrenzter öffentlicher Ressourcen und wachsender gesellschaftlicher Ängste die Gefahr wächst, dass marginalisierte Personengruppen wie z.B. Suchtkranke weniger Hilfe und Aufmerksamkeit erfahren, Stigmatisierungsprozesse zunehmen und Hilfeangebote zurückgefahren werden. Suchtkranke haben selbst wenig Möglichkeiten, sich aus dieser Situation zu befreien, und sind hier in besonderer weise auf die Anwaltschaft professioneller Helfer angewiesen. Die Tagung soll an verschiedenen Beispielen zeigen, welche spezifischen Personengruppen gemeint sind und welche Unterstützungsoptionen bestehen.
Silke Brigitta Gahleitner: Soziale Arbeit als Beziehungsprofession: Qualifizierte Suchtarbeit
Frau Gahleitner ist Professorin für Klinische Psychologie und Sozialarbeit, Beratung und Therapie an der Alice Salomon Hochschule in Berlin.
Sie beschäftigt sich mit der Qualifizierung von SozialarbeiterInnen als Beziehungsprofession und hat auf europäischer Ebene eine ECCSW-Zertifizierung erarbeitet, die das Profil des Berufsbildes der Sozialarbeit schärfen soll. An einem Fallbeispiel erläutert sie, dass der schrittweise Beziehungsaufbau von marginalisierten, bindungsgestörten KlientInnen z.B. im Obdachlosen- oder Drogenmilieu methodisch angegangen werden muss und eine spezifische Qualifikation erfordert, die in der Ausbildung zur SozialarbeiterIn vermittelt wird und sich unterscheidet von anderen Qualifikationen z.B. in der Psychotherapie. Für das Verständnis niederschwelliger Suchtarbeit nicht nur aus der Sozialarbeit heraus, sondern auch in der vernetzten gemeindepsychiatrischen Versorgung in multidisziplinären Teams ist dieser Professionalisierungsansatz von herausragender Bedeutung. Verantwortungsgemeinschaften in der Suchtarbeit setzen intensive methodisch geleitete Beziehungsarbeit voraus.
Jürgen Piek: Gesundheitliche Situation und medizinische Versorgung wohnungsloser Suchtkranker
Prof. Dr. Jürgen Piek war früher Professor für Neurochirurgie an der Universitätsklinik Rostock und engagiert sich jetzt für die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen auf der Straße, auch solchen mit chronischen Suchterkrankungen.
In seinem Vortrag stellt er die Arbeit der Ambulanz in der Turmstraße in Berlin vor, des Arztmobils und der Krankenwohnung Turmstraße. Die Ambulanz in der Turmstraße richtet sich an gehfähige Menschen, die selbstständig Behandlung aufsuchen können. Das Arztmobil fährt beliebte Aufenthaltsorte wohnungsloser Menschen ab und behandelt vor Ort Menschen mit medizinischem Bedarf, die sich Hilfe wünschen. Die Krankenwohnung nimmt wohnungslose Menschen auf sta, die stationären Behandlungsbedarf hätten, die in einem Krankenhaus nicht gewährleistet werden könnten, darunter auch viele Abhängigkeitserkrankungen. Nach Ansicht von Prof. Piek ist eine langfristige Lösung nur möglich, indem Behandlungsangebote geschaffen werden, die Menschen sowohl bei der Wohnungslosigkeit als auch bei der Suchterkrankung und bei den körperlichen Erkrankungen helfen.
Andreas Bechdolf: Soulspace und Fritz: Junger Menschen mit psychischen Erkrankungen und Komobidität
Prof. Bechdolf ist Chefarzt des Vivantes Klinikums für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Urban.
In seinem Vortrag stellt er das Frühinterventions- und Therapiezentrum (FRITZ) der Klinik vor. Es bietet Hilfe sowohl bei psychischen als auch bei arbeitsplatzbezogenen Problemen an. Es gibt ein "Stepped-care"-Angebot, das individuell zugeschnittene Hilfsangebote macht. Der Fokus liegt auf der Behandlung junger psychoseerkrankter Menschen, von denen ein Großteil auch Substanzen, v.a. Cannabis konsumiert. Die Behandlung zielt auf einen langfristigen Beziehungsaufbau, eine größere Akzeptanz von Gesundheitsangeboten, das gemeinsame explorieren der Anliegen der Betroffnen, aktuelle Krisen verstehen und bewältigen sowie Identitätsentwicklung und Autonomieförderung. Durch die FRITZ-Behandlung schaffen es 54 % der Patienten, ihren Substanzkonsum zu beenden, was zu deutlich positiveren Behandlungsverläufen in Bezug auf die Psychoseerkrankungen führt. Die Suchtabteilung der Klinik hat 2022 den Community Reinfocement Approach als Behandlungskonzept für ihre SuchtpatientInnen in der Klinik eingeführt.
Elke Papenberg: Denen ist ja nicht mehr zu helfen: Netzwerke für Systemsprenger am Beispiel Münster
Elke Papenberg, Sozialarbeiterin im Haus der Wohnungslosenlhilfe der Bischof Hermann Stiftung in Münster, berichtet in ihrem beeindruckenden Vortrag vom Münsteraner Netzwerk für sog. "Systemsprenger". Die angesprochene Klientel zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine massive Überforderung für die meisten Hilfeeinrichtungen darstellt. Sie sind häufig sehr aggressiv und erweisen sich als nicht gemeinschaftsfähig. Oft sind sie nicht versichert und nicht kooperativ. Sie lehnen empfohlene Medikamente ab und achten oft nicht ausreichend auf ihre Hygiene. Der in Münster gegründete Arbeitskreis Systemsprenger versucht, Politik und Verwaltung sowie die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Dabei entstand das Sytemsprenger-Wohnprojekt, das darauf abzielt, Systemsprenger zu vereinzeln, indem sie in einzelnen Wohnungen im intensiv ambulant betreuten Wohnen (IBW) untergebracht werden. Für die MitarbeiterInnen stellt es oft eine Herausforderung dar, mit Frustrationen und potentiellen Gefahrensituationen umzugehen sowie akzeptanzorientiert zu arbeiten. Ziele seien es, den Menschen aus der Wohnungslosigkeit zu helfen, Straftaten zu verringern, ihre psychische Gesundheit zu verbessern und ihnen medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Darius Tabatabai: Bedarfsorientierte Hilfe für Suchtkranke am Beispiel des Therapieverbundes Hamburg
Darius Tabatabai, Psychiater und Geschäftsführer des Therapiehilfeverbundes Hamburg, stellt in seinem Vortrag die Einrichtungen des Therapieverbundes Hamburg vor. Der Verbund richtet sich v.a. an Menschen mit schweren Behandlungsverläufen. Darius Tabatabai vermittelt eine Einführung in die Arbeiten der Palette Hamburg, des Winternotprogramms für wohnungslose Menschen, die Einrichtung La Campagne in Bremen sowie eine geplante stark strukturierte Einrichtung in Bremen. Eine gute Kooperation der verschiedenen Hilfeeinrichtungen im Rahmen der gemeindepsychiatrischen Versorgung und bei der Behandlung der Betroffenen sei unverzichtbar. Sektorübergeifende und hybride Arbeitsmodelle sowie digitale Hilfeangebote müssten gefördert werden. Abstinenz dürfe nicht zur ultimativen Voraussetzung für bedeutsame Hilfeangebote gemacht werden. Das gelte in besonderer Weise für die ambulante Psychotherapie.
Svenja Ketelsen: Solidarität für marginalisierte UnionsbürgerInnen: Unterstützung statt Rückführung
Svenja Ketelsen von der BAG Wohnungslosenhilfe in Berlin berichtet in ihrem ergreifenden Vortrag von den Diskriminierungen und Benachteiligungen von zugezogenen EU-Bürgern aus Ost-, Süd- und Mitteleuropa, v.a. Rumänien, Polen und Bulgarien, die in Deutschland auf Arbeitssuche sind. Grundproblem ist, dass die EU eine Wirtschaftsunion, aber keine Sozialunion ist. Oft hängt die Unterbringung dieser Personen vom Arbeitsplatz ab, was Arbeitsausbeutung begünstigt. Bei Verlust des Arbeitsplatzes landen die Betroffenen oft in der Wohnungslosigkeit. Selbst mit Unterstützung fällt es vielen von ihnen schwer, ihre Leistungsansprüche gegenüber den deutschen Behörden durchzusetzen. Auch der Zugang zum Gesundheitssystem ist erheblich erschwert, da EU-Bürgerinnen in ihren Heimatländern oft nicht krankenversichert sind. Notfallbehandlungen werden vom Sozialamt erstattet. Hier lohnt es sich, Ansprüche zu prüfen. Anderweitige Behandlungen sind nur über Clearingstellen und Arztpraxen für Menschen ohne Versicherungsschutz möglich. Das gilt auch für den Zugang zum Suchthilfesystem. Svenja Ketelsen wirbt dafür, den betroffenen Personen einen einfacheren Zugang zu Sozialleistungen zu ermöglichen. Wichtig ist dafür, die Sprachbarriere abzubauen.